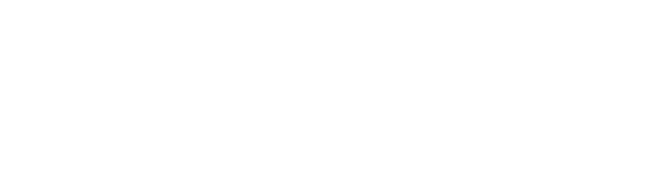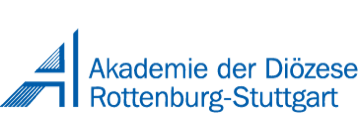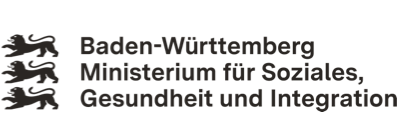Zwischen Alltagsdiskriminierung und strukturellem Rassismus: Muslimfeindlichkeit als gesamtgesellschaftliche Herausforderung
Am 22. Juli 2025 fand im Tagungszentrum Hohenheim die Fachtagung „Muslimfeindlichkeit in Deutschland“ statt. Gastgeber:innen waren die Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart und zahlreiche Kooperationspartner, darunter das Demokratiezentrum Baden-Württemberg mit der Fachstelle Extremismusdistanzierung (FEX), die Landeszentrale für politische Bildung, das Landeskriminalamt Baden-Württemberg sowie die Muslimische Akademie Heidelberg. Die Veranstaltung fand in Hybridform statt und widmete sich einem zentralen gesellschaftlichen Thema. Sie bot vielfältige Perspektiven auf Ursachen, Erscheinungsformen und Handlungsoptionen gegen Muslimfeindlichkeit und antimuslimischen Rassismus.
Zum Auftakt begrüßte Dr. Christian Ströbele, Leiter des Fachbereichs Interreligiöser Dialog an der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, die rund 100 Teilnehmenden herzlich vor Ort und an den Bildschirmen. In seinem Eingangsstatement stellte Ströbele die Tagung in den Kontext von zehn Jahren erfolgreicher Islamberatung in Baden-Württemberg, einem Projekt, das Kommunen, Einrichtungen und Organisationen dank der Förderung des Sozialministeriums kostenfrei unterstützt. Besonders hob er die zunehmende gesellschaftliche und fachliche Bedeutung von Muslimfeindlichkeit und antimuslimischem Rassismus hervor, die sich im Beratungsalltag – auch in der Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen aus Bildung, Integration, Sicherheitsbehörden und Zivilgesellschaft – immer deutlicher zeige. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen verwies Ströbele auch auf die jüngste Stellungnahme zur demokratischen Kultur, in der die Bedeutung einer offenen, vielfältigen und inklusiven Gesellschaft hervorgehoben wird. Er unterstrich, dass der Einsatz gegen Muslimfeindlichkeit und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit integraler Bestandteil des demokratischen Selbstverständnisses und der gesellschaftlichen Verantwortung sei. Angesichts der anhaltenden Brisanz des Themas formulierte Ströbele den Anspruch, mit der Tagung nicht nur zur fachlichen Diskussion, sondern auch zur Stärkung einer demokratischen Streit- und Handlungskultur beizutragen – stets im Geist gemeinsamen gesellschaftlichen Gestaltens.
Nicht am Rand, sondern mitten unter uns: Wie Muslimfeindlichkeit den Alltag prägt
Den inhaltlichen Auftakt gestaltete Prof. Dr. Dr. Mathias Rohe, Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung an der FAU Erlangen Nürnberg. Er stellte zentrale Ergebnisse der vom Bundesinnenministerium beauftragten Studie Muslimfeindlichkeit – Eine deutsche Bilanz vor. Dieser Bericht bietet erstmals eine umfassende Bestandsaufnahme zum Thema Muslimfeindlichkeit in Deutschland. Basierend auf Analysen, Studien, Fallbeispielen und Anhörungen verdeutlicht er die verschiedenen Formen und Wirkungsweisen sowie die gesamtgesellschaftliche Bedeutung von Muslimfeindlichkeit. Dabei wird deutlich, dass Muslimfeindlichkeit kein Randthema ist, sondern ein gesamtgesellschaftliches und strukturelles Problem. Der Bericht ruft zu entschiedenem Handeln in Politik, Bildung, Justiz, Medien und Zivilgesellschaft auf. Nur durch nachhaltige und wirksame Maßnahmen lassen sich Ausgrenzung überwinden und die chancengleiche Teilhabe aller sichern. In seinem Vortrag spannte Rohe einen Bogen von historischen Entwicklungen bis zu aktuellen Problemlagen: Trotz positiver institutioneller Entwicklungen – wie dem Aufbau islamischer Theologien an Hochschulen – seien Diskriminierungserfahrungen für viele Muslim:innen weiterhin Teil des Alltags. Besonderes Augenmerk legte er auf die subtile, oft unbewusste Muslimfeindlichkeit in der gesellschaftlichen Mitte. Diese manifestiert sich beispielsweise im Bildungsbereich, auf dem Arbeitsmarkt oder in der Justiz. So hätten Studien – etwa das viel rezensierte Bewerbungs-Experiment von Doris Weichselbaumer – eindrücklich gezeigt, wie sehr muslimische Frauen, insbesondere jene, die äußerlich als Musliminnen erkennbar sind (z.B. durch das Tragen eines Kopftuchs), erhebliche Hürden bei der Jobsuche überwinden müssen, selbst wenn die Qualifikation identisch ist. Neben rechtlichen Aspekten thematisierte Rohe die Rolle von Medien und Bildungsmedien. Muslimisches Leben in Deutschland wird in Schulbüchern wie auch in Filmen und Nachrichten meist verzerrt oder auf problematische Aspekte reduziert, während Alltagsrealitäten selten abgebildet sind. Auch die Begrifflichkeit „Muslimfeindlichkeit“ diskutierte Rohe differenziert. Er plädierte dafür, Muslimfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit und antimuslimischen Rassismus jeweils kontextsensibel und ergänzend zu verwenden, um sowohl individuelle Vorurteile als auch institutionelle Mechanismen in den Blick zu nehmen.

Muslimfeindlichkeit als strukturelle Herausforderung in Gesellschaft, Medien und Bildung
Im anschließenden Podiumsgespräch beleuchteten Matthias Rohe, Birte Freer (CLAIM – Allianz gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit) und Derya Şahan (Abteilungsleiterin der FEX/Mitglied des SWR-Rundfunkrats) die aktuelle Lage aus zivilgesellschaftlicher, medienethischer und wissenschaftlicher Perspektive.
Birte Freer erinnerte zunächst an den rechtsextremen und rassistischen Anschlag in München am 22. Juli 2016, um daran exemplarisch deutlich zu machen, dass solche Gewalt tödliche Folgen haben kann und die gesellschaftlichen wie individuellen Auswirkungen weit über den eigentlichen Tatmoment hinausreichen. Aktuelle Zahlen und Einzelfälle aus dem Lagebild zu antimuslimischen Rassismus und Antimuslimischen Vorfällen zeigen, dass im Jahr 2024 über 3.000 antimuslimische Vorfälle dokumentiert wurden, ein deutlicher Anstieg von 60% im Vergleich zum Vorjahr. Besonders deutlich wurden dabei strukturelle Ausschlüsse und die starke Betroffenheit von Frauen. Ergänzt wurden die Befunde unter anderem durch Erhebungen der EU-Grundrechteagentur, die das Ausmaß von Diskriminierungserfahrungen auf europäischer Ebene verdeutlichen und der Studie: Grenzen der Gleichheit: Rassismus und Armutsgefährdung des Deutsches Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) die zeigt, dass die Armutsgefährdungsquote von muslimischen Männern und Frauen im Vergleich zu nicht rassistisch markierten Männern bzw. Frauen 4-mal so hoch ist. Im Anschluss an die vorgestellten Befunde formulierte die Claim-Allianz zentrale Empfehlungen für den Umgang mit antimuslimischem Rassismus. An erster Stelle steht die bessere und systematische Erfassung von Vorfällen durch Polizei und Zivilgesellschaft, wofür eine einheitliche Definition antimuslimischen Rassismus notwendig ist. Claim forderte zudem verpflichtende Schulungen im öffentlichen Dienst und eine verlässliche Finanzierung von Monitoring und Beratungsangeboten. Wichtig sei außerdem der Ausbau unabhängiger, spezialisierter Beratungsstellen, etwa in Schulen, Verwaltungen und Polizeidienststellen. Die Überarbeitung von Lehrplänen sowie Bildungsmaterialien ist ebenso unerlässlich, da Muslim:innen darin noch immer überwiegend stereotyp oder problemorientiert erscheinen. Politisch dringend notwendig ist aus Sicht von Claim die explizite und differenzierte Aufnahme antimuslimischen Rassismus‘ – ebenso wie anderer Rassismusformen – in den Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus. Die kontinuierliche Einbindung von Betroffenen, Migrant:innenorganisationen und zivilgesellschaftlichen Akteuren wurde ebenso betont wie der Ausbau gezielter Informationsangebote und Rechtshilfefonds. Zusammenfassend wies Claim darauf hin, dass antimuslimischer Rassismus kein Randproblem, sondern eine strukturelle Herausforderung und ein Angriff auf die Demokratie ist – entsprechende Gegenmaßnahmen müssen daher dauerhaft und nachhaltig gestaltet werden.
Derya Şahan eröffnete ihren Beitrag mit dem Zitat: „Rassismus tötet“. Sie unterstrich, wie sehr gerade antimuslimischer Rassismus reale und oft fatale Auswirkungen hat. Diese Auswirkungen betreffen nicht nur für Einzelne, sondern die Demokratie insgesamt. Zugleich betonte sie die Bedeutung, Räume zu schaffen, in denen Stimmen von Betroffenen auch tatsächlich gehört werden. Mit Blick auf die Medienlandschaft sprach Şahan aus der Innensicht einer Rundfunkrätin. Seit Oktober 2020 ist sie als erste muslimische Frau in ein Rundfunkratsgremium der ARD berufen. Diese Berufung ist das Ergebnis jahrelangen Engagements muslimischer Organisationen und des politischen Willens auf Landesebene. Ihre Vertretungsrolle bringt dabei eine doppelte Verantwortung mit sich: Einerseits Fragen der Sichtbarkeit und Teilhabe muslimischen Lebens im gesellschaftlichen Diskurs aufmerksam zu begleiten, andererseits aber auch dafür einzustehen, dass muslimische Perspektiven in der Berichterstattung differenziert und fair vertreten werden. Şahan machte eindrücklich deutlich, dass Muslimfeindlichkeit maßgeblich auch durch mediale Bilder und Sprache (mit-)geprägt wird. Repräsentative Studien wie die der Otto Brenner Stiftung zur Zusammensetzung und Arbeitsweise der öffentlich-rechtlichen Rundfunkgremien zeigen, dass in den Aufsichtsgremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks die soziokulturelle Vielfalt der Gesellschaft nur unzureichend repräsentiert ist – ein demokratiepolitisch relevantes Defizit, das sich auch auf Programmgestaltung und Themenwahl auswirkt. In nur drei von neun ARD-Anstalten gibt es bislang eine muslimische Vertretung; viele entscheidungstragende Positionen seien weiterhin durch eine ausgesprochen homogene Gruppe besetzt. Nach fünf Jahren im Rundfunkrat zieht Şahan Bilanz: Vielfalt in Programm und Redaktion bleibt ein zentrales Entwicklungsziel. Redaktionen arbeiten zwar inhaltlich mit hohem Engagement, doch die mangelnde Diversität in den Teams sorge unweigerlich für blinde Flecken, stereotype Bilder und Defizitorientierungen. Muslimisches Leben werde medial zu häufig als Problem, Konflikt oder Defizit sichtbar gemacht; insbesondere muslimische Frauen mit Kopftuch sind in der Berichterstattung oft negativ oder vereinfacht dargestellt. Şahan betonte daher die Notwendigkeit, die interne Vielfalt zu stärken und Zugänge in Medienhäuser zu schaffen, damit Journalist:innen mit unterschiedlichsten Lebensrealitäten selbst Themen setzen können. Nur so ließen sich pauschalisierende Darstellungen und stereotype Bilder überwinden. Darüber hinaus, so Şahan, braucht es sowohl in der Berichterstattung als auch in den Kontrollgremien vermehrt Brückenbauer:innen, die Austausch fördern, Begegnungsräume schaffen und hilfebedürftige Stimmen gezielt unterstützen. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, so die abschließende Überzeugung der Rednerin, trägt eine gemeinsame, demokratische Verantwortung für die faire und inklusive Repräsentation aller Bevölkerungsgruppen. Im Kampf gegen Muslimfeindlichkeit beginnt gesellschaftliche Teilhabe dabei bereits in den Strukturen der Berichterstattung selbst.
Rohe betonte die Bedeutung von aktiver Unterstützung und Zugängen für Neueinsteiger:innen in gesellschaftliche Organisationen, in denen bestehende Strukturen stark durch etablierte Akteur:innen geprägt sind. Konkret plädierte er dafür, dass erfahrene Mitglieder gezielt Newcomer:innen fördern, um eine größere Diversität und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Ein zentrales Anliegen für Rohe war die Verankerung rassismuskritischer Kompetenzen in der Grundausbildung aller relevanten Professionen, insbesondere in der Lehrer:innenbildung. Es reiche nicht aus, ausschließlich besonders aufgeschlossene Gruppen mit Extraveranstaltungen zu sensibilisieren; vielmehr sei es notwendig, antidiskriminierende Perspektiven fest in den Strukturen und Curricula zu verankern. Mit Blick auf die rechtliche Ebene sah Rohe Verbesserungsbedarf im geltenden Antidiskriminierungsrecht. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) genüge insbesondere hinsichtlich intersektionaler Diskriminierungsformen noch nicht. Zudem fehle dem AGG Klarheit und Verbindlichkeit bei der Einbindung staatlicher Institutionen, da Länderstrukturen teils divergierende Standards setzten. Abschließend betonte er, dass schon symbolische gesetzliche Regelungen eine wichtige Signalwirkung hätten. Sie machen Rechte sichtbar, auf die sich Betroffene berufen können, und wirken präventiv gegenüber diskriminierendem Verhalten. Rohe ermutigte, mit Ausdauer und Hartnäckigkeit gesellschaftliche und politische Veränderungsprozesse einzufordern.
Beratung, Teilhabe, Empowerment: Handlungsansätze aus Praxis und Verwaltung
Am Nachmittag stand der Austausch zu praxisnahen Handlungsansätzen und Bedarfe im Umgang mit Muslimfeindlichkeit im Fokus.
Aysun Pekal vom Sozialdienst muslimischer Frauen (SMF) eröffnete das Podium mit einem anschaulichen Einblick in die Arbeit des Verbands. Sie betonte, dass der SMF bundesweit als wichtige Anlaufstelle für Beratung, Empowerment und soziale Unterstützung fungiere. Zentral für die Arbeit sei der Abbau von Vorurteilen und die Förderung gesellschaftlicher Teilhabe – nicht nur für Frauen, sondern mittlerweile auch für Jugendliche, Männer und Familien. Die Finanzierung sozialer Projekte bleibt dennoch ein Dauerthema: Die oft kurzfristigen Förderperspektiven erschweren eine nachhaltige Begleitung, etwa im Bereich der Demokratiebildung und Präventionsarbeit. Im Alltag, so Pekal, begegnet Muslimfeindlichkeit den SMF-Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen in vielfältigen Formen – von offenen Diskriminierungen in Bildungseinrichtungen und Behörden bis hin zu subtilen Alltagsrassismen. Besonders betroffen seien muslimische Frauen mit Kopftuch, die oft Mehrfachdiskriminierung ausgesetzt sind. (Siehe hierzu auch die Online-Umfrage: Ermittlung von Rassismuserfahrungen der Ehrenamtlichen.) Viele Betroffene hätten sich inzwischen an Feindseligkeiten gewöhnt oder seien unsicher, ob das Erlebte tatsächlich als Diskriminierung einzustufen sei. Pekal hob hervor, wie wichtig niederschwellige, communitynahe Beratungsstellen sind, um Betroffene zu stärken und ihnen langfristig neue Handlungssicherheit zu geben. Gleichzeitig beklagte sie, dass gut ausgebildete muslimische Fachkräfte zunehmend Auswanderungswünsche äußerten – eine Entwicklung, die als Warnsignal für ein belastetes Integrationsklima gewertet werden müsse.
Dr. Nina Guérin, Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Landes Baden-Württemberg (LADS), schilderte das breite Aufgabenfeld ihrer Institution. Die LADS ist eine zentrale Anlaufstelle für Betroffene jeglicher Diskriminierungsart und arbeitet mit einem Netzwerk kommunaler und zivilgesellschaftlicher Beratungsstellen zusammen. Obwohl antimuslimischer Rassismus ein relevanter Fallbereich ist, zeigten die Erfahrungen, dass die Zahl gemeldeter Vorfälle vergleichsweise niedrig bleibt. Guérin verwies dabei auf mangelnde Bekanntheit, Informationsdefizite und die verbreitete Skepsis Betroffener gegenüber dem Nutzen einer Meldung. Sensibilisierungsmaßnahmen, fachliche Weiterbildung und der Ausbau von Multiplikator:innenprojekten in den Communities wurden als wichtige strategische Ziele betont.
Fatma Gül aus der Abteilung Integrationspolitik der Stadt Stuttgart berichtete von ihrer praxisnahen Arbeit mit Moscheegemeinden und dem Arbeitskreis Stuttgarter Muslime. Während das Thema Muslimfeindlichkeit bis vor kurzem in vielen Gemeinden wenig offen thematisiert wurde, sei mittlerweile das Bedürfnis nach aktiver Bearbeitung deutlich gewachsen. Gül betonte die Wichtigkeit von Vertrauen, Aufklärung und niedrigschwelligen Zugängen – sowohl innerhalb der Community als auch gegenüber städtischen Anlaufstellen. Sie schilderte Beispiele für erfolgreiche Kooperationen, etwa im Bereich Empowerment und in Ausstellungsprojekten, wies jedoch auch auf den Bedarf an strukturierten Netzwerken und spezifischen Anlaufstellen hin.
Dr. Michael Blume, Beauftragter der Landesregierung gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben, bettete die Diskussion in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext der Vielfalt und den Kampf gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ein. Er schilderte seinen Arbeitsalltag zwischen Politik, Medien und Communitys, verwies auf die Herausforderungen der zunehmenden Polarisierung, der Radikalisierung im Netz und der Instrumentalisierungsversuche rechtspopulistischer Akteure. Blume warnte davor, verschiedene Minderheitengruppen gegeneinander auszuspielen und forderte demokratische Parteien auf, sich aktiv für Zusammenhalt, Solidarität und Respekt einzusetzen. Auch er beobachtet einen Vertrauensverlust vieler junger Menschen, mahnte jedoch, dass Solidarität nicht verordnet werden kann, sondern von der Gesellschaft aktiv gelebt werden muss.
Ein zentrales Fazit der Podiumsdiskussion lautete: Nachhaltige Strategien im Umgang mit Muslimfeindlichkeit, gezielte Empowerment-Angebote, dauerhafte Beratungsstrukturen, mehr Sichtbarkeit und umfassende Netzwerk- und Allianzenarbeit auf Augenhöhe sind erforderlich. Das Zusammenwirken von zivilgesellschaftlichem Engagement, Verwaltung, Politik und Medien bleibt dafür zentral.
Muslimfeindlichkeit institutionell begegnen
Karim Saleh schilderte in seinem Impuls die vielschichtigen Herausforderungen im institutionellen Umgang mit Muslimfeindlichkeit, insbesondere anhand seiner Erfahrungen als Fachberater der FEX und der Islamberatung Baden-Württemberg. Dabei betonte er, dass es in den Praxiskontexten häufig weniger um klassische Präventionsarbeit gehe, sondern vielmehr um die Begleitung und Beratung nach bereits eingetretenen Konflikten oder Vorfällen. Im Bildungsbereich zeige sich, dass problematische oder diskriminierende Aussagen oft erst erkannt würden, wenn sie offen eskalieren. Zwar sei die Sensibilität in Schulen bei Themen wie Queerfeindlichkeit, Antisemitismus oder Anti-Schwarzer Rassismus spürbar gestiegen, jedoch blieben Erfahrungen mit antimuslimischem Rassismus häufig unbenannt oder unsichtbar. Viele muslimische Schüler:innen würden primär als „Täter:innen“ wahrgenommen, ihre Erfahrungen als Betroffene gerieten in den Hintergrund. Saleh konstatierte, dass Schulen selten explizit das Thema Muslimfeindlichkeit aufgreifen. Wenn problematische Haltungen auftreten, drehten sich Reaktionen schnell um die religiöse Identität (z. B. „muslimische Schüler:in“ versus „deutsche Schüler:in“) und marginalisierten dadurch Mehrfach-Zugehörigkeiten. Ein zentrales Problem sei die Unsicherheit im Umgang mit Vorfällen. Viele Fachkräfte wüssten entweder nicht, wie sie angemessen reagieren sollen, oder fühlten sich auf institutioneller Ebene alleingelassen. Es fehle häufig an klaren Strukturen, abgestimmten Handlungsplänen und nachhaltiger Unterstützung. Der Umgang hänge häufig vom Engagement einzelner Lehrkräfte oder Sozialarbeiter:innen ab, statt systematisch verankert zu sein. Am Beispiel der Kommunalverwaltungen wurde deutlich, dass muslimisches Leben meist dann als Problemfeld erscheint, wenn es sichtbar wird – etwa beim Moscheebau. Während Fachverwaltungen oft professionell und neutral agierten, entstünden Widerstände vor allem auf der kommunalpolitischen Ebene und im gesellschaftlichen Umfeld. Fehlendes Wissen und Unsicherheit über den Islam seien weit verbreitet, ebenso der Wunsch nach „neutraler“ Expertise durch externe Fachstellen, anstatt muslimische Akteur:innen vor Ort einzubeziehen. Im Umgang mit Themen wie Bekleidungsvorschriften oder Grabfeldgestaltung kristallisiere sich immer wieder ein Spannungsfeld zwischen Zugehörigkeit, Religionsfreiheit und Gleichbehandlung heraus, häufig begleitet von stereotypen Bildern oder Ressentiments. Abschließend zeigte Saleh am Praxisbeispiel Polizei, dass es auch positive Entwicklungen gibt. Etwa durch Programme wie das Pat:innenprojekt, das Polizist:innen für Diversität und religionsbezogene Themen sensibilisiert. Allerdings, so betonte er, hingen Fortschritte stark von einzelnen Menschen und Projekten ab. Noch immer mangle es an systematischer Verankerung, und Muslim:innen würden im öffentlichen Diskurs oft vornehmlich als „anders“ oder potenzielle Problemträger:innen wahrgenommen. Sein Fazit: Unsicherheit, fehlendes Wissen und mangelnde Handlungskompetenz prägen vielerorts den Umgang mit Muslimfeindlichkeit in Institutionen. Notwendig seien mehr strukturelle Klarheit, kontinuierliche Aufklärungsarbeit und eine feste Verankerung des Themas auf allen Ebenen, um mehrfaches „Othering“ zu verhindern und die Rechte sowie das Zugehörigkeitsgefühl muslimischer Menschen in der Gesellschaft nachhaltig zu stärken.

Institutioneller Alltag im Fokus: Muslimfeindlichkeit in Schule und Verbänden
Im abschließenden Podium der Fachtagung rückten die unterschiedlichen Erfahrungen und Herausforderungen im Umgang mit Muslimfeindlichkeit im institutionellen Alltag erneut in den Mittelpunkt. Dabei kamen die zentralen Praxisfelder: Schule, Verwaltung und muslimische Verbandsarbeit miteinander ins Gespräch.
Hakan Turan (Gymnasiallehrer, Lehrbeauftragter am Schulseminar Stuttgart) ergänzte die Perspektive aus der schulischen Praxis. Er wies darauf hin, dass muslimfeindliche Aussagen oder Zuschreibungen im Schulalltag häufig nicht klar benannt oder bearbeitet würden – oftmals, weil Lehrkräfte unsicher seien, wann und wie sie angemessen intervenieren sollten. Diskriminierung reiche von offenen Beleidigungen mit islamfeindlicher Konnotation bis hin zu subtilen Othering und einer fehlenden Thematisierung. Muslimische Schüler:innen und Lehrkräfte berichteten immer wieder von Verletzungen und mangelnder Ansprechbarkeit durch das Kollegium. Sichtbare muslimische Lehrkräfte könnten, so Turan, einerseits zur Normalisierung muslimischer Lebensrealität im Schulalltag beitragen, stünden jedoch auch vor besonderen Herausforderungen. Die Erfahrungsberichte zeigten, dass es niedrigschwelliger Vertrauenspersonen und eine bessere Vernetzung auf kollegialer Ebene braucht, um Ausgrenzung und Unsicherheiten wirklich entgegenzuwirken.
Erdinç Altuntaş (Landesvorsitzender DiTiB BW) brachte die Perspektive der muslimischen Gemeinden und Verbände ins Gespräch. Moscheegemeinden seien täglich mit den Folgen von Muslimfeindlichkeit konfrontiert, angefangen bei Diskriminierung auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt bis hin zu Angriffen auf Moscheen und Alltagsrassismen. Altuntaş betonte, dass Verbände wie DiTiB nicht nur religiöse, sondern auch soziale, kulturelle und bildungsbezogene Dienste für eine breite Community anbieten. Allerdings fühlten sich die Verbände von Politik und Verwaltung häufig nur aufseiten von Problemanzeigen, nicht als Teil der Lösung wahrgenommen. Es bedürfe eines stärkeren Dialogs auf Augenhöhe, professionellerer Verbandsstrukturen und mehr Wertschätzung für die konkrete Integrations-, Sozial- und Präventionsarbeit, die in den Gemeinden geleistet werde. Altuntaş verwies darauf, dass systematische Angriffe und Übergriffe auf Moscheen durch interne Antidiskriminierungsstellen dokumentiert und gemeldet werden, jedoch politische Reaktionen und Schutzmaßnahmen vielfach ausblieben.
Mit Blick nach vorn wurde die Notwendigkeit diskutiert, Normalität und Zugehörigkeit sichtbarer zu machen, Wissenstransfer und Systemkenntnis in den Communities und Institutionen zu stärken und Muslim:innen nicht auf Integrationsdefizite oder Sonderstellungen zu reduzieren, sondern als selbstverständlichen Teil der deutschen Gesellschaft zu begreifen und zu behandeln.

Fazit und Perspektiven: Was bleibt, was folgt?
Im abschließenden Rückblick gab Tim Florian Siegmund (Islamberatung Baden-Württemberg) einen kompakten Überblick über die zentralen Eindrücke und Erkenntnisse des Veranstaltungstages. Er verwies eingangs auf die vielfältigen Perspektiven, die im Verlauf der Tagung zusammengetragen wurden und betonte noch einmal, dass Muslimfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus keine Randthemen seien, sondern eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung darstellen, die eng mit anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit verwoben ist. Als wiederkehrendes Leitthema zog sich durch den Tag, dass Diskriminierungserfahrungen letztlich zu Vertrauensverlust, erschwerter Teilhabe und gesellschaftlicher Polarisierung führen und damit nicht nur Betroffene, sondern die gesamte Gesellschaft schwächen. Er erinnerte an zentrale Befunde: So weisen etwa Studien darauf hin, dass rund die Hälfte der deutschen Bevölkerung antimuslimische Vorurteile hegt. Im Laufe der Panels wurde deutlich, dass die gesellschaftliche Diskursverschiebung nach rechts und eine zunehmende Enthemmung dazu führen, dass Vorurteile und Diskriminierungen immer sichtbarer – und zum Teil auch sagbarer – werden. Antimuslimischer Rassismus ist kein Phänomen, das nur „am rechten Rand“ auftritt, sondern in der gesellschaftlichen Mitte präsent ist und einen Angriff auf Grundrechte aller darstellt. Abschließend verwies Siegmund auf positive Ansätze und konkrete Projekte, etwa das Netzwerk junger Musliminnen oder interaktive Ausstellungsinitiativen, die muslimisches Leben in der Stadtgesellschaft sichtbarer machen, Vernetzung fördern und damit nachhaltige Impulse gegen Muslimfeindlichkeit setzen.
Christian Ströbele griff in seinen abschließenden Worten den Appell an kontinuierliche Alltags-Solidarität auf. Er unterstrich die Rolle von Netzwerkarbeit, Kooperation und Fachöffentlichkeit als zentrale Hebel, um Muslimfeindlichkeit wirksam entgegenzutreten und lud die Teilnehmenden ein, weiter im Austausch zu bleiben.