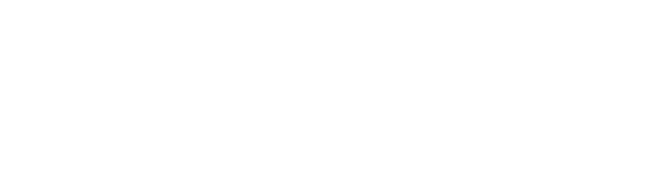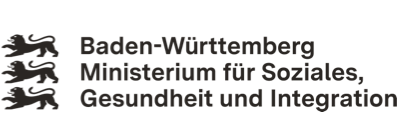Die Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart und die Stiftung Weltethos luden zu einer Diskussion über das Friedensabkommen von Dayton ein, das vor 30 Jahren den Bosnienkrieg beendete. Hat das Dayton-Abkommen tatsächlich Frieden gebracht oder lediglich den Krieg beendet? Welche Rolle spielen Religionsgemeinschaften bei der Überwindung oder Verfestigung nationalistischer Narrative? Und welche Lehren lassen sich aus der bosnischen Erfahrung für gegenwärtige Konflikte ziehen?

Wie Dr. Christian Ströbele in seiner Begrüßung betonte, knüpft die Akademie damit an eine Tradition an: Bereits vor 20 Jahren organisierten die Akademiereferenten Hansjörg Schmid und Klaus Barwig eine Journalistenreise nach Sarajevo unter dem Titel „10 Jahre nach Dayton“. Die damaligen Fragen nach ethnischer Homogenisierung, der Nachhaltigkeit westlichen Engagements und der Rolle des bosnischen Islam als „einzigem Islam europäischer Prägung“ mit langer Tradition hätten, so Ströbele, „mindestens noch dieselbe Aktualität wie vor 20 Jahren“.
Die Veranstaltung fand im Rahmen der Islamberatung Baden-Württemberg statt, die vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration des Landes Baden-Württemberg gefördert wird. Dabei erweise sich, wie Ströbele berichtete, die Zusammenarbeit mit der islamischen Gemeinschaft der Bosniaken in Baden-Württemberg vielerorts als fruchtbar: Sie stellt einen verlässlichen Partner in unterschiedlichen Kontexten – etwa beim islamischen Religionsunterricht, bei der Konstituierung islamischer Theologie in Europa und der Interaktion in vielen Kommunen vor Ort. Die bosnisch-islamische Erfahrung eines europäisch geprägten, in pluralen Kontexten gewachsenen Islam bietet somit nicht nur historische Lehren für den Umgang mit nationalistischer Mobilisierung, sondern auch praktische Impulse für das Zusammenleben.
Historischer Kontext: Das Recht des Stärkeren
Professor Dr. Stefan Schreiner eröffnete mit einer grundlegenden These: Das Dayton-Abkommen markiere den Beginn einer Ära, in der nicht mehr „die Stärke des Rechts“ gelte, sondern „das Recht der Stärkeren“. Diese Zeitenwende habe nicht 2022 mit dem Ukraine-Krieg begonnen, sondern bereits in den 1990er Jahren nach dem Zerfall Jugoslawiens.
Schreiner zeichnete den Weg zum Dayton-Abkommen nach: Die internationale Gemeinschaft habe den Krieg zunächst als „Bürgerkrieg“ definiert – eine Kategorisierung, die er als fundamentalen Fehlgriff bezeichnete. „Man spricht von einem Zivilkrieg, von einem Bürgerkrieg, aber es sind drei Präsidenten verschiedener Länder, die einen Vertrag zur Beendigung des Krieges unterzeichnen.“
Das Abkommen selbst sei von vorsichtigen Formulierungen geprägt: Man sprach nicht von „Grenzen“, sondern von „Trennlinien“, nicht von „ethnischen Säuberungen“ sondern von „displaced persons“. Diese sprachliche Zurückhaltung spiegele eine grundlegende „moralische Unehrlichkeit“ wider, so Schreiner. Der damalige bosnische Präsident Alija Izetbegović habe das Abkommen treffend bewertet: „Das ist kein gerechter Friede, aber er ist besser als die Fortsetzung des Krieges.“
Die Binnen- und Erfahrungsperspektive

Mohammed Jugo, Berater für die Beziehungen mit der westlichen Welt bei der Islamischen Gemeinschaft in Bosnien-Herzegowina, bot einen Einblick in die gelebte Realität des Dayton-Systems. Er beschrieb die „außerordentlich komplizierte Struktur“ des Staates: zwei Entitäten (die Föderation Bosnien-Herzegowina und die Republika Srpska), 16 Regierungen mit rund 160 Ministern, ein rotierendes Präsidium und das übergeordnete Amt des Hohen Repräsentanten.
Besonders dramatisch sei oft die Situation der Rückkehrer: „In vielen Städten in der Republika Srpska ist der Imam mit seiner Familie die einzige oder die einzige Familie, die nicht serbisch ist. Das tut uns vor allem weh.“ Er berichtete von der paradoxen Situation, dass nach dem Krieg serbische Politik orthodoxe Bewohner aufforderte, Sarajevo zu verlassen: „In dieser Hysterie haben viele auch ihre Toten mitgenommen. Also ausgegraben und nach Ost-Sarajevo oder in andere Städte mitgenommen.“
Jugo verglich die Hoffnungen von vor 20 Jahren mit der heutigen Realität: „Damals schien mir, dass die politische Lage in Bosnien sehr stabil gewesen ist. Und ich hatte die Hoffnung, dass in zehn, zwanzig Jahren mit Sicherheit Bosnien einheitlich sein wird.“ Heute sei die Lage jedoch in mancher Hinsicht „viel schlimmer“.
In einem bewegenden Appel verglich Jugo die Situation mit der deutschen Nachkriegsgeschichte und verwies auf Konrad Adenauers „Teppichrede“ von 1949: „Das war keine Geste der Macht, sondern eine Geste moralischer Gleichheit.“ Während Deutschland durch den Marshallplan „nicht nur seine Ökonomie erneuern, sondern auch das Vertrauen der Welt zurückgewinnen“ konnte, habe Bosnien-Herzegowina „eine solche Chance nie bekommen“. Seine zentrale Frage lautete: „Ist es für Bosnien-Herzegowina an der Zeit, aus politischer Notwendigkeit in moralische Reife hineinzuwachsen?“
Ideologiekritische Perspektive: Nationalistische Mobilisierung

Professorin Dr. Amina Omerika von der Universität Frankfurt analysierte die ideologischen Mobilisierungsmechanismen, die zum Krieg führten und bis heute nachwirken. Sie stellte klar: „Das war kein Religionskrieg“, betonte aber zugleich, dass Religion „strukturell eng mit ethnischer, mit nationaler Zugehörigkeit verknüpft“ werde.
Omerika identifizierte historische Narrative als „wichtigste Fundierung der nationalistischen Ideologien“. Die zentrale Frage, die immer wieder gestellt wurde: „Wem gehört Bosnien-Herzegowina?“ Für serbische Nationalisten erschien Bosnien als „historischer Bestandteil des serbischen Raumes“, kroatische Nationalisten erhoben ebenfalls territoriale Ansprüche. Nur für die muslimische Bevölkerung, die heutigen Bosniaken, stellte Bosnien-Herzegowina „den einzigen territorialen Rahmen dar, in dem sie als politische Gemeinschaft existieren“ konnten.
Besonders wirkmächtig war laut Omerika die serbische Mobilisierung durch den Amselfeld-Mythos. Die Schlacht von 1389 wurde „nicht als historisch komplexes Ereignis dargestellt, sondern als dramatischer Wendepunkt, als Moment, in dem Freiheit und Staatlichkeit fielen und ein Landeszeitalter des Leidens begann“. Slobodan Milošević habe bei der 600-Jahr-Feier 1989 diese „Vergangenheitserzählung zu einer politisch mobilisierenden Symbolik“ gebündelt.
Auf kroatischer Seite dominierte der „Mythos“ eines „antemurale Christianitatis“ – die Vorstellung Kroatiens als „westlich-katholisches Bollwerk“ gegen das als „orientalisch und zivilisatorisch minderwertig“ konstruierte Andere. Dabei wurde „das, was zuvor das als orientalisch-byzantinisch markierte Andere war, nun stärker islamisiert und zunehmend direkt mit Muslimen identifiziert“.
Ein besonders alarmierender Befund Omerikas: Diese Narrative wirken bis heute in „globalen rechtsextremen Milieus“ nach. Der Christchurch-Attentäter Brenton Tarrant bezeichnete sich als „Kebab Remover“ – ein direkter Bezug auf serbische paramilitärische Gewalt. „In seinem Manifest tauchen Begriffe wie Kosovo oder Bosnien hunderte Male auf. Für ihn war der Bosnien-Krieg ein Modell, in dem die Serben die Rolle der Verteidiger Europas gegen die Muslime einnahmen.“
Die Rolle der Religionsgemeinschaften
Zur Frage nach der Rolle der Religionsgemeinschaften bei der Überwindung oder Verstärkung nationalistischer Narrative bot die Diskussion differenzierte Antworten. Jugo berichtete, dass der Interreligiöse Rat „seit 1996 sehr aktiv bei der Schlichtung“ sei, „wenn es vor allem Angriffe auf Kirchen, Moscheen und andere Religionsgemeinschaft-Infrastruktur gibt“. Allerdings räumte er ein: „Leider können die Religionsgemeinschaften und Kirchen nur wenig tun, weil die Politik eigentlich die Macht hat.“
Omerika bezeichnete die Rolle als „durchaus ambivalent“. Einerseits gebe es „institutionalisierte Bemühungen“, andererseits säßen im Interreligiösen Rat „gleichzeitig Leute, die vor drei Jahren noch die Kriegsmaschinerie mitgetragen haben oder Waffen gesegnet haben“. Positiv bewertete sie Initiativen junger Theologinnen und Theologen aller drei Konfessionen, „die sich treffen, Erfahrungen austauschen, Initiativen ergreifen“.
Professor Schreiner warnte vor der Instrumentalisierung religiöser Zugehörigkeit: „Wenn ich eine Religion mit einer Politik identifiziere, dann mache ich auch einen politischen Konflikt unlösbar.“ Religion sei „nicht verhandelbar“ und entziehe sich „jedem politischen Kompromiss“.
Sarajevo als Sonderfall
Mehrfach wurde Sarajevo als positive Ausnahme genannt – eine Stadt, in der multiethnisches Zusammenleben noch funktioniere. Jugo präzisierte: „In Sarajevo gibt es nur eine legitime Teilung: Wer ist für den Fußballverein Željezničar und wer für Sarajevo.“ Die Synagoge, katholische Kathedrale, orthodoxe Kathedralen und Moscheen seien „in der ganzen Stadt verteilt“.
Omerika relativierte jedoch: „Wir können sowieso nicht von dieser Entwicklung auf einer Gesamtebene des Staates sprechen.“ Sarajevos besondere Rolle habe historische Gründe als „kosmopolitische osmanische Stadt“, aber auch damit zu tun, dass es als „Zentrum der Republik sozusagen diesen multiethnischen Outlook auch behalten sollte“. Im Gegensatz dazu sei etwa Mostar „komplett zweigeteilt“ – „nicht nur durch den Fluss“.
Diskussionsergebnisse: Zwischen Hoffnung und Resignation
Die Diskussion offenbarte ein fundamentales Spannungsfeld. Einerseits wurde der (islamische) Religionsunterricht als Erfolgsgeschichte genannt: Dieser „funktioniert in ganz Bosnien überall“, so Jugo. Andererseits existierten „zwei Schulen unter einem Dach“, wo Kinder „zusammen im Garten spielen – und wenn sie zum Unterricht gehen, werden sie dann geteilt“.
Die demografische Entwicklung wurde als besonders alarmierend dargestellt. Omerika beschrieb ihre Eindrücke: „Jeder, der kann, ergreift die Gelegenheit, dieses Land zu verlassen.“ Jugo berichtete von seinen Besuchen in der Region: „Ich habe mich so wie in einem Warteraum gefühlt. Alle warten irgendwie: Wann kommt das Visum?“ Es gebe „Ortschaften, die ausschließlich aus Rentnern bestehen“.
Ein kontroverser Punkt war die Wahrnehmung von außen. Auf die Frage, warum europäische Besucher zunächst nach „neuen Moscheen“ fragten, antwortete Jugo eindringlich: „Alle wurden zerstört, die zerstört werden konnten im Krieg.“ Er schilderte die Risiken des Wiederaufbaus: Bei der Grundsteinlegung einer Moschee in seiner Heimatstadt „wurde ein Bosniake umgebracht, erschossen, obwohl der US-Botschafter dabei war“.
Schreiner ergänzte kritisch zur selektiven Wahrnehmung: „Wenn man vom Flughafen in die Stadt fährt, hat man rechter Hand die große saudi-arabische Moschee.“ Dies werde sofort als Beleg für „politischen Islam“ gedeutet, ohne zu berücksichtigen, „dass das in eine Situation gebaut wurde, in der einige Jahre früher nahezu alle Moscheen zerstört worden sind, religiöses Personal in Konzentrationslager gestellt und gefoltert wurde“.

Lehren für die Gegenwart
Zur Frage, welche Lehren Europa aus Bosnien hätte ziehen müssen, formulierte Schreiner eine deutliche Warnung: „Wo führt es hin, wenn das Recht des Stärkeren als Recht anerkannt wird?“ Die „Instrumentalisierung religiöser Vorbehalte im Sinne eines Feindbildes“ mache politische Konflikte unlösbar.
Omerika betonte die Fragilität demokratischer Ordnungen: „Man wacht eines Tages auf und das Land, in dem man aufgewachsen ist, von dem man glaubt, komplett stabil gewesen zu sein, existiert de facto nicht mehr und stattdessen ist da Krieg, Zerstörung und noch Schlimmeres.“ Sich „zurückzulehnen und zu sagen, uns wird es nicht betreffen, weil wir sind ja besser dran und weiter entwickelt, ist eine Illusion und das ist auch naiv“.
Ströbele wies auf den bemerkenswerten Beitrag der bosnischen islamischen Theologie hin: „weil wir da Kolleginnen und Kollegen haben, die gerade dieses Thema der theologischen Ideologiekritik, der Aufarbeitung von Ideologien seit Jahrzehnten betreiben.“ Dies sei „eine große Bereicherung für den Umgang mit Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, Ethnonationalismus aus theologischer Perspektive“.
Fazit und Ausblick
Die Veranstaltung machte deutlich: 30 Jahre nach Dayton ist Bosnien-Herzegowina ein Land im Wartezustand. Das Abkommen hat den Krieg beendet, aber keinen Frieden im eigentlichen Sinne geschaffen. Die ethnischen Säuberungen wurden de facto legitimiert, nationalistische Narrative wirken fort und finden sogar globale Resonanz in rechtsextremen Kreisen.
Jugo brachte die Diskrepanz zwischen bosnischer Lebenswirklichkeit und europäischer Wahrnehmung auf den Punkt: Wenn ausländische Besucher fragen, ob in öffentlichen Schulen „Jungs und Mädchen getrennt“ sind, antworte er: „Sie sind in ein europäisches Land gekommen. Es ist alles gleich wie in München, nur wir haben nicht den BMW.“
Die zentrale Frage bleibt, ob Bosnien-Herzegowina – um mit Jugos Worten zu sprechen – „von einem Vertrag des Friedens zu einem Vertrag des Gewissens“ kommen kann, „in dem die Vergangenheit nicht ausgelöscht, sondern zum Fundament einer verantwortlichen Zukunft gemacht wird“. Die Veranstaltung zeigte: Der Weg dorthin ist weit, und Europa trägt eine Mitverantwortung, die es bislang nur unzureichend wahrgenommen hat.
Dr. Christian Ströbele
Weiterführende Berichte:
Vatican News: Bosnien – Stabiler Frieden 30 Jahre nach dem Dayton-Abkommen?