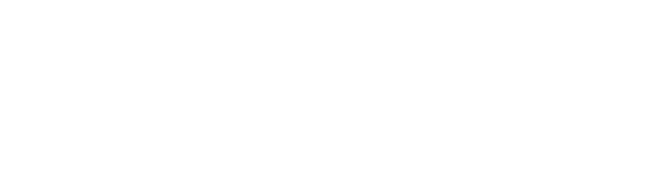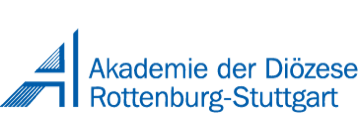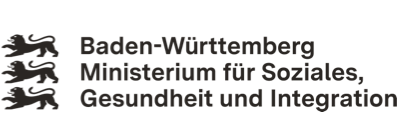Zehn Jahre Islamberatung – Zehn Jahre gelebte Verantwortung
Zur Jubiläumsveranstaltung der Islamberatung Baden-Württemberg versammelten sich am 2. Juli 2025 zahlreiche Gäste, Wegbegleiter:innen und Kooperationspartner:innen, um auf ein Jahrzehnt zurückzublicken, in dem ein regional und bundesweit beachtetes Projekt gewachsen ist. Die Veranstaltung bot nicht nur einen Rückblick auf Erfolge und Herausforderungen, sondern eröffnete auch den Blick für die Zukunft einer vielfältigen Gesellschaft. Die Atmosphäre war geprägt von Wertschätzung, nachdenklichen Tönen und der spürbaren Überzeugung, dass die Islamberatung einen unverzichtbaren Beitrag zum gesellschaftlichen Miteinander leistet.
Dr. Christian Ströbele, Fachbereichsleiter für Interreligiösen Dialog an der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart und Projektleiter, eröffnete den Abend und begrüßte die Gäste, darunter Bischof em. Dr. Gebhard Fürst, Ordinariatsrätin Karin Schieszl-Rathgeb, Barbara Janz-Späth (Interimsdirektorin der Akademie), Vertreter:innen der Robert Bosch Stiftung und des Sozialministeriums sowie viele weitere Unterstützer:innen, die das Projekt über die Jahre hinweg getragen haben. Herr Ströbele betonte, dass die Islamberatung ohne die enge Zusammenarbeit mit Partner:innen aus Kirche, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft nicht denkbar wäre. Besonders hob er dabei auch die Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl hervor, die mit ihrer wissenschaftlichen Begleitung und ihrer Praxisnähe zu den Abläufen des kommunalen Verwaltungswesens einen wichtigen Beitrag leistet.
Gesellschaft unter Nachbarn gemeinsam gestalten
Im anschließenden Grußwort betonte Frau Ordinariatsrätin Karin Schieszl-Rathgeb, Leiterin der Hauptabteilung XI – Kirche und Gesellschaft des Bischöflichen Ordinariats der DRS, die Islamberatung als Ausdruck gelebter gesellschaftlicher Verantwortung. Sie erinnerte an die Anfänge des Projekts, welche sie im Büro des damaligen Bischofs Gebhard Fürst persönlich miterleben durfte, und würdigte die nachhaltige Wirkung: Seit 2015 wurden bundesweit über 280 Beratungen durchgeführt. Diese Beratungen seien dabei „mehr als nur ein Termin“ – immer ging und geht es dabei „um Menschen“, Begegnungen und darum, wie Vielfalt zur gemeinsamen Gestaltung von Gesellschaft beitragen kann. Sie sprach offen über die Herausforderungen, die mit der öffentlichen Wahrnehmung muslimischen Lebens verbunden sind, und hob hervor, wie die Islamberatung Räume für echte Begegnung und Verständigung schafft – auch und gerade bei Konflikten wie Moscheebau, Gebetsruf oder Fragen der Religion im öffentlichen Raum, wie sie auch die christlichen Kirchen beschäftigen. Die Islamberatung, so Schieszl-Rathgeb, sei ein Modell, das nicht zuletzt auch in der Tradition christlicher Soziallehre steht: nicht abgrenzend, sondern öffnend, nicht rückziehend, sondern Verantwortung übernehmend – ganz im Sinne der Enzyklika Laudato si’ von Papst Franziskus. Es werde ein deutliches Zeichen für Verantwortung, Verbundenheit und gesellschaftliche Nachhaltigkeit gesetzt.

Karin Schieszl-Rathgeb © Schewe I Akademie
Ein Rückblick durch persönliche Einblicke von Hussein Hamdan
Im Mittelpunkt des Abends stand das Gespräch zwischen Christian Ströbele und Hussein Hamdan, dem langjährigen Leiter der Islamberatung und seit 2024 Projektleiter von „Brückenbauen in der Kommune – Muslimische Teilhabe und gesellschaftliches Zusammenleben im DACH-Raum“ bei der Eugen-Biser-Stiftung. Dr. Hamdan blickte mit spürbarer Emotionalität auf die vergangenen Jahre zurück, in denen er das Projekt maßgeblich prägte. Er schilderte, wie aus einer kleinen Idee ein landesweit gefragtes Beratungsangebot wurde, das Kommunen, muslimische Gemeinden, Vereine, Schulen und Pflegeeinrichtungen unterstützt. Hamdan sprach offen über die Herausforderungen im Team, über Reibungen mit Partnern, aber auch über die unglaubliche Leistung, die gemeinsam erzielt werden konnte.
So schilderte Hamdan beispielsweise eine Vermittlung im Zusammenhang mit einem Moscheebau in einer Gemeinde. Dort suchte der Bürgermeister Rat, da der Gemeinderat der örtlichen DITIB-Gemeinde skeptisch gegenüberstand. Hamdan vermittelte dort mit Sachlichkeit und Empathie und konnte so Vorurteilen und Ängsten mit viel Geduld begegnen, sodass viele Skeptiker:innen ihre Haltung überdachten. Hamdan betonte jedoch auch: Die Islamberatung ist nicht dafür da, den Bau von Moscheen durchzusetzen, sondern steht ein für Neutralität, Fairness und Teilhabe. Doch auch schwierige und emotionale Beispiele wurden nicht ausgespart. Hamdan berichtete von Fällen, in denen alevitische Gräber geschändet wurden, und von der Verantwortung, auch innerhalb der muslimischen Community für Sensibilität und Respekt zu werben. Die Bedeutung von islamischer Bestattungskultur, die Herausforderungen beim Einbezug von Minderheiten wie den Aleviten oder Ahmadiyya sowie der Umgang mit gesellschaftlichen Kontroversen – etwa beim öffentlichen Gebetsruf in der Corona-Zeit in Köln – wurden als zentrale Themen der Beratungsarbeit benannt. Hamdan zeigte sich nicht zuletzt auch selbstkritisch, sprach über phasenweise Fehler im Umgang mit muslimischen Verbänden, für die er sich zu Beginn seiner Arbeit selbst verantwortlich sieht, aber vor allem über die Notwendigkeit für Politik und Gesellschaft, Haltung zu zeigen im Kampf gegen den antimuslimischen Rassismus.

Exkurs:
Christian Ströbele verweist auf eine spannende Episode von PressF, in der Hussein Hamdan über die Chancen und Herausforderungen der Islamberatung in Deutschland spricht. Dabei werden zentrale Fragen thematisiert: Wie können Moscheegemeinden aktiver Teil des gesellschaftlichen Lebens werden? Welche Hürden gibt es bei der Integration – und wie lassen sich Vorurteile überwinden?
Podiumsdiskussion: Vernetzung, Modellcharakter und Zukunftsthemen
Im Anschluss diskutierten auf dem Podium Volker Nüske (Robert Bosch Stiftung), Fatma Gül (Integrationsbeauftrage der Stadt Stuttgart), Natascha Garvin (Koordinatorin für Zusammenleben in Vielfalt in Dornbirn, Österreich), Hussein Hamdan und Christian Ströbele. Die Diskussion verdeutlichte die Breite und Tiefe der Islamberatung:
Volker Nüske unterstrich den Modellcharakter des Projekts, das für gesellschaftlichen Zusammenhalt einsteht und das inzwischen auch in weiteren Bundesländern (Bayern, zeitweise in NRW, und in Sachsen) Entsprechungen hat. Zudem werden pilothaft Projekte in Österreich und der Schweiz unterstützt und mit Erfahrungen in deutschen Kommunen zusammengesehen. Die Islamberatung sei ein Inkubator für Innovationen im Umgang mit religiöser Vielfalt, ein Ort des Lernens und der strategischen Netzwerkbildung.
Fatma Gül schilderte aus kommunaler Perspektive, wie die Islamberatung bei Integration, religionssensibler Pflege, Bestattung, Teilhabe und der Unterstützung (junger) muslimischer Netzwerke in Stuttgart unverzichtbar geworden ist. Sie betonte die Bedeutung von Dialog und der Einbindung aller Moscheegemeinden.
Natascha Garvin berichtete von der europäischen Vernetzung im Rahmen des DACH-Projekts: In sechs Kommunen in Deutschland, Österreich und der Schweiz werden Projekte u.a. zu muslimischem Leben und dessen Sichtbarkeit, zu Pflege und Altern umgesetzt. Die Islamberatung bietet hier Orientierung, Vernetzung und nachhaltige Prozessbegleitung. In der Diskussion wurde deutlich, dass die Islamberatung nicht nur auf aktuelle Herausforderungen reagiert, sondern auch Zukunftsthemen wie Einsamkeit, internationale Konflikte und die Stärkung von Selbstvertretung muslimischer Communities aktiv aufgreift.

Stimmen aus dem Publikum: Wertschätzung und Ausblick
Das Publikum, darunter Vertreter:innen muslimischer Organisationen, Kirchen, Verwaltung und Zivilgesellschaft, brachte in der offenen Fragerunde weitere Aspekte ein: Die Bedeutung religionssensibler Bestattung, die Herausforderung, auch geflüchteten Muslim:innen würdige Begräbnisse zu ermöglichen, und der Wunsch nach noch mehr nachhaltigen Strukturen für Beratung und Fortbildung wurden betont. Die Schulungsreihe „Islam im Plural“ wurde als besonders wertvoll hervorgehoben und der Bedarf an weiteren Informationsangeboten unterstrichen. Auch kontroverse Themen, wie der öffentliche Gebetsruf, wurden offen diskutiert. Dabei wurde deutlich: Die Islamberatung ist ein Ort, an dem auch schwierige Fragen ausgehalten, besprochen und in Lösungen überführt werden.

Ein Angebot mit Zukunft
Die 10-jährige Jubiläumsveranstaltung der Islamberatung Baden-Württemberg zeigte eindrucksvoll, wie aus der Idee ein nachhaltiges, bundesweit und international beachtetes Angebot wurde. Heute ist die Islamberatung mehr als ein Projekt – sie ist ein lebendiges Netzwerk, ein Ort des Dialogs, der Qualifizierung, der Konfliktbearbeitung und der gesellschaftlichen Innovation. Ihre Stärke liegt in der Verbindung von Neutralität und Empathie, von Sachverstand und Haltung. Sie schafft Vertrauen, wo Misstrauen herrscht, und eröffnet Wege, wo andere Probleme sehen.
(von Amelie Penka)