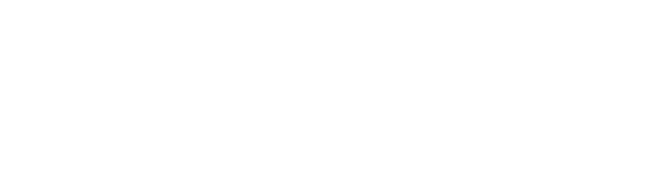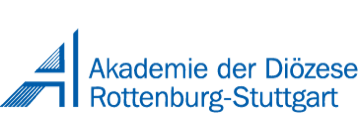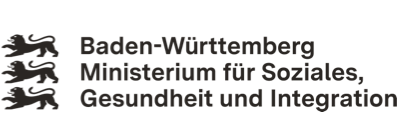Am 26. Juni 2025 fand im Tagungszentrum Hohenheim der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart unter der Moderation von Dr. Christian Ströbele der diesjährige Projekttag der Islamberatung Baden-Württemberg statt. Die Beraterinnen und Berater der Islamberatung sprachen von aktuellen Themen in der kommunalen Zusammenarbeit und von neuen Herausforderungen angesichts des Nahostkonfliktes.
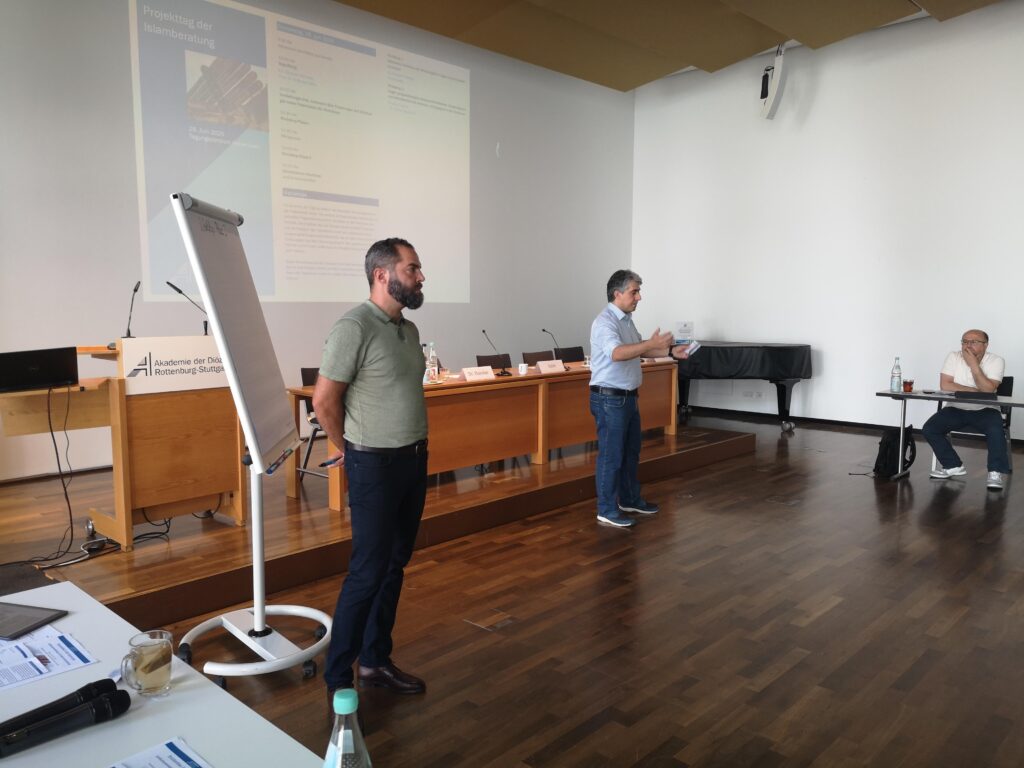
Auch in diesem Jahr kamen wieder zahlreiche kommunale Integrationsbeauftragte sowie Vertreterinnen und Vertreter von islamischen Organisationen und Interessierte zusammen, um sich in Fragen des Dialoges mit muslimischen Mitbürgern zu informieren. Zu diesem Zweck führte das Beraterteam der Islamberatung zwei Workshops unter den Titeln „Islamische Verbänden und diesbezüglichen Fragen in kommunalen Kontexten“ sowie „Islamfeindlichkeit und Antisemitismus in der Kommune erkennen und begegnen“ durch.
Unter Leitung von Seniorberater Dr. Hussein Hamdan und Karim Saleh wurde im Workshop „Islamische Verbände und diesbezügliche Fragen in kommunalen Kontexten“ erläutert, dass lokale islamische Gemeinden häufig wegen ihres medial belasteten Dachverbandes – wie bspw. DİTİB – in Mithaftung genommen werden. Dr. Hamdan erzählte dabei, dass es kaum eine Beratung gegeben habe, in der kommunale Vertreter nicht auf den DİTİB-Bundesverband oder gar auf die türkische Politik zu sprechen gekommen waren. Obwohl die lokalen Ehrenamtlichen in aller Regel keine oder kaum Verbindungen zu den Bundesstrukturen des Verbandes pflegen, bleibe der Verdacht einer möglichen Einmischung der türkischen Politik in den Hinterköpfen der Verantwortlichen, was ein Teilnehmer mit der Parole „Keine Moschee für Erdoğan“ ironisierend zusammenfasste. Zwar stellt sich letztlich oftmals heraus, dass es mit der lokalen islamischen Gemeinde keinerlei wirkliche Probleme gibt. Dennoch schadet der schlechte Ruf der Dachverbände häufig den lokalen Ablegern, was in einem erschwerten Dialog voller Misstrauen beiderseits endet, da sich die islamischen Gemeinden unter Generalverdacht gestellt fühlen.
Die Gründe dieses Misstrauens gegenüber DİTİB sieht Dr. Hamdan in der meist negativen medialen Präsenz sowie in zahlreichen Fehlinformationen. Letztere umfassen beispielsweise die Behauptung, der Verband werde vom Bundesverfassungsschutz überwacht, obwohl dies nicht zutrifft. Allerdings wurde auch diskutiert, dass die Türkei und ihre Politik im Alltag vieler Deutschtürken auch noch in der dritten Generation nach der Einwanderung eine zentrale Rolle spielen. Dies sei auch eine Identitätsfrage, betonte Karim Saleh, der für die Zukunft plurale Identitäten sieht, die einen Ausgleich zwischen muslimischer Herkunft und deutschen Lebenswelten schaffen.
Weitere Probleme in der kommunalen Zusammenarbeit liegen in der oftmals fehlenden Struktur und Professionalisierung islamischer Organisationen auf kommunaler Ebene: Oftmals stehen ältere Ehrenamtliche den Verbänden vor, deren Vertretungsmacht unklar ist und die zum Teil mit Sprachbarrieren zu kämpfen haben. Es ist daher für städtische Beauftragte schwierig, einen dauerhaften und „offiziellen“ Ansprechpartner zu finden. Die daraus folgende Konsequenz mancher Kommunen, die Zusammenarbeit zu reduzieren oder gar „Islampolitik“ ohne die betroffenen Musliminnen und Muslime zu gestalten, ist zum Scheitern verurteilt. Vielmehr fühlen sich die betroffenen Mitbürgerinnen und Mitbürger dann gegenüber anderen Gruppierungen und Religionsgemeinschaften zurückgesetzt und ignoriert. Dies baut letztlich wieder Barrieren auf, die eigentlich abgebaut werden sollten.
In Fragen der Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene bleibt also das Hauptanliegen der Islamberatung – Wissen zu schaffen und den Dialog zu eröffnen und erweitern – weiterhin mehr als aktuell.
Im zweiten Workshop zum Thema „Islamfeindlichkeit und Antisemitismus in der Kommune erkennen und begegnen“ unter der Leitung von Simone Trägner und Tim Florian Siegmund wurde zu Beginn mithilfe eines Kurzfilmes die Absurdität von Alltagsrassismus porträtiert: Eine katholische Nonne musste sich dabei vor Passanten für ihren Habit und Glauben rechtfertigen und provokative Fragen beantworten. Diese sprichwörtliche Umkehrung der Medaille stand stellvertretend für die vielen Menschen muslimischen Glaubens, denen jeden Tag nicht nur nervige, verletzende Fragen gestellt werden, sondern auch offene Feindschaft entgegengebracht wird. Der Schritt von der Bildung eines Stereotyps zum Vorurteil ist dabei schnell in den Köpfen der Menschen gemacht und befeuert Diskriminierung und Feindlichkeit. Wichtig sei deshalb, so Trägner, dass besonders auf kommunaler Ebene die Verwaltungsangestellten und Lehrkräfte in dieser Hinsicht geschult werden. Nur so könne man Muslimfeindlichkeit erkennen und ihr begegnen. Ein großes Problem stellt jedoch die zunehmende Arbeitsbelastung der kommunalen Angestellten dar, so dass oftmals keine hinreichenden Schulungen oder Trainings möglich seien.
Neben der Muslimfeindlichkeit hat auch der Antisemitismus in Deutschland zugenommen. Seit dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel im Oktober 2023 und der darauffolgenden israelischen Militärintervention haben sich die Straftaten mit antisemitischem Beweggrund verdoppelt. Tim Florian Siegmund erläuterte in diesem Zusammenhang eine Arbeitsdefinition, was Antisemitismus bedeutet und beinhaltet. In der Diskussion anhand kritischer Fälle wurde offenbar, dass auch unsere Gesellschaft noch immer verkennt, dass auch in Kritik am Staat Israel und dessen Politik oft versteckter Antisemitismus transportiert wird. Dies sei insbesondere dann der Fall, wenn der Staat Israel dämonisiert wird, während Staaten, die eine ähnliche Politik betreiben, nicht gleichermaßen angeprangert werden. Anhand verschiedener Beispiele konnte Siegmund zeigen, dass auch auf Demonstrationen häufig antisemitische Stereotype bedient und bisweilen spätmittelalterliche antijudaistische Legenden in Form von Parolen und Darstellungen verwendet werden. Über die Frage, ob sich die Verfasser und Ersteller entsprechender Parolen und Darstellungen des antisemitischen Gehalts und Ursprungs im Klaren waren und welche Folgen dieses (Nicht-)Bewusstsein habe, entsprang eine fruchtbringende Abschlussdiskussion im Workshop.
von Dominic Scheim